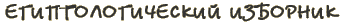KÖHLER, Ursula, Das Imiut. Untersuchungen zur Darstellung und Bedeutung eines mit Anubis verbundenen religiösen Symbols. Teil A und B, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975
(17 x 24 cm; Teil A (= Katalog) XV + 319 p., 6 fig., 5 tables, 12 pl.; Teil B (Theoretischer Teil) p. 321-529)
= Göttinger Orientforschungen. Veröffentlichungen des Sonderforschungsbereiches Orientalistik an der Georg-August-Universität Göttingen. IV. Reihe: Ägypten, 4.
Teil A stellt zunächst die frühesten Darstellungen des Imiut bis zur IV. Dyn. vor, dann folgt ein nach Merkmalen geordneter Katalog mit Angaben über Gattung, zeitliche Verteilung und Herkunft der Quellen, chronologische Liste der Belege, Stellung des Typs im Zusammenhang, Charakteristika, Abgrenzung zu den anderen Typen, Entwicklung, Variable, zeitliche Einordnung und das Verhältnis zu den übrigen Typen. Die kanonisierte Form des Imiut entsteht in der III. Dynastie aus Elementen, die in der I. Dyn. bereits verwendet werden, und findet sich als einzige Form bis zur XVIII. Dyn. In deren zweiter Hälfte wird die Kanon-Form variiert, um sich in der XXVI. Dyn. wieder stärker der ursprünglichen Form zu nähern. Eine weitere Variante erscheint von der XVIII. Dyn. bis zur Ptolemäerzeit. Die Kanon-Form wird vor allem in königlichen Szenen und den Darstellungen des offiziellen Kultes verwendet. Belege auf privaten Quellen von der XIX. Dyn. ab zeigen mehr oder weniger starke Abweichungen und werden daher in einer Variatio nengruppe und einer Sondergruppe mit je drei Untergruppen abgehandelt. Ein Überblick über die Attribute des Imiut (Stab, Napf, Uas u. a.) leitet über zu einer Zusammenstellung der Szenen, in welchen das Imiut auftritt.
Im theoretischen Teil B wird die These, das Imiut-"Symbol" sei nichts anderes als eine Form des Anubis-Schakals, anhand von Denkmälern und Textzeugnissen erhärtet. Der kopflose Schakalbalg "Imiut" wäre demnach ein Tiernumen, das, durch Abschlagen des Kopfes und durch Kappung seiner Läufe unschädlich gemacht, dem Verstorbenen durch Fressen und Wegschleppen der Leichenteile nicht mehr gefährlich werden kann, ihm jedoch als Vehikel für die Wiedergeburt dient, deren Voraussetzung das Verschlungenwerden, später ersetzt durch die Balsamierung, ist. So wird Anubis zum "Herrn der Erneuerung durch die Bestattung und die dazu benötigten Mittel". Zunächst ist es nur der König, welcher durch den ursprünglich ortsungebundenen Anubis wiedergeboren wird. Die Rolle im Hebsed als "Erneuerer" fördert das Verständnis des Anubis-Balges als Symbol der Lebenserneuerung und Lebenskraft. Auch der Verstorbene kann durch die Wiedergeburt zum Anubis werden. Hier ergibt sich eine Parallele zu Horus. Durch seine Funktion ergeben sich auc h Angleichungen an die Götter Seth, Baby, eine Kuhgöttin und andere, und an Dämonen in den Sargtexten und späteren Totentexten, bei welchen wieder der negative Aspekt des Anubis-Imiut als Verschlinger der Toten mehr betont wird. Den Namen Imiut leitet Vf. von wt-"einhüllen", "Mumienbinde" ab und erklärt ihn als "Anubis, der selbst die Hülle ist" bzw. als "Anubis, der den Umhüller darstellt".